1. Lichtbogenschweißen mit Elektrode
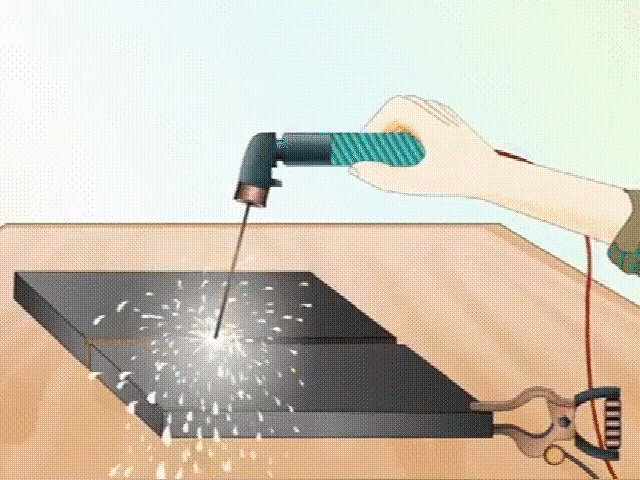
Beim Lichtbogenschweißen wird zwischen Schweißdraht und Werkstück ein stabiler Lichtbogen gezündet, der zum Aufschmelzen von Schweißdraht und Werkstück und damit zur Bildung einer festen Schweißverbindung führt. Während des Schweißvorgangs zersetzt sich die Schutzschicht aus Schweißpulver, schmilzt und bildet Gase und Schlacke. Diese schützen die Elektrodenspitze, den Lichtbogen, das Schmelzbad und dessen Umgebung vor schädlicher Verunreinigung des Schmelzguts durch die Atmosphäre. Der Schweißdrahtkern schmilzt unter der Einwirkung des Lichtbogens weiter und bildet zusammen mit dem Schweißgut einen Bestandteil der Schweißnaht.
2. Unterpulverschweißen

Das Unterpulverschweißen (einschließlich des Elektroschlackeschweißens usw.) ist ein Schweißverfahren, bei dem ein Lichtbogen in der Flussmittelschicht unter dem Schweißgut gezündet wird. Es zeichnet sich durch hohe Schweißqualität und -stabilität, hohe Schweißproduktivität, geringe Lichtbogenbildung und wenig Schweißrauch aus und hat sich daher zu einem der wichtigsten Schweißverfahren bei der Herstellung von Druckbehältern, Rohrleitungen, Kastenträgern und Stützen sowie anderen wichtigen Stahlkonstruktionen entwickelt.
3. Argon-Lichtbogenschweißen(WIG-Schweißen)
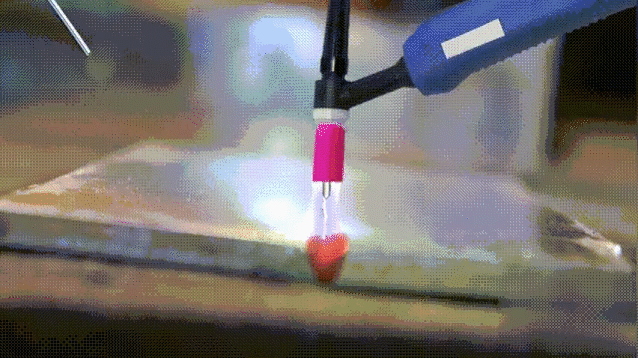
Argon-Lichtbogenschweißen (WIG-SchweißenBeim Argon-Schutzgasschweißen wird Argon als Schutzgas verwendet. Es handelt sich dabei um ein Schweißverfahren, bei dem der Lichtbogen unter Schutzgasatmosphäre geschweißt wird. Die Luft wird außerhalb des Schweißbereichs eingeschlossen, um eine Oxidation zu verhindern.
Die Argon-Lichtbogenschweißtechnologie basiert auf dem Prinzip des herkömmlichen Lichtbogenschweißens. Dabei wird das Schweißgut durch Argon-Schutzgas geschützt. Durch den hohen Stromfluss wird das Schweißgut im Grundwerkstoff verflüssigt und bildet ein Schmelzbad. Dadurch entsteht eine metallurgische Verbindung zwischen dem zu schweißenden Metall und dem Schweißgut. Da das heiße Schmelzbad ständig mit Argon versorgt wird, kann das Schweißgut nicht mit dem Sauerstoff der Luft in Kontakt kommen und somit nicht oxidieren. Dadurch können Edelstahl und Eisenmetalle geschweißt werden.
4. Gasschweißen

Gasschweißen, auch bekannt als Sauerstoff-Brennstoff-Schweißen (OFW). Bei diesem Schweißverfahren wird eine Mischung aus Brenngasen und Acetylen als Wärmequelle genutzt, um das Schweißgut zu schmelzen und eine interatomare Verbindung herzustellen. Als Brenngas dient hauptsächlich Sauerstoff, als Brenngas hauptsächlich Acetylen oder Flüssiggas.
5. Laserschweißen

LaserschweißenBeim Laserschweißen wird ein fokussierter Laserstrahl als Energiequelle genutzt, um die Schweißnaht mit der beim Schweißen entstehenden Wärme zu bestrahlen. Aufgrund der Brechung, Fokussierung und anderer optischer Eigenschaften des Lasers eignet sich das Laserschweißen besonders für Kleinstteile und schwer zugängliche Bereiche. Es zeichnet sich außerdem durch geringen Wärmeeintrag, geringen Schweißverzug und Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Feldern aus.
Aufgrund der hohen Kosten des Lasers und der geringen elektrooptischen Umwandlungseffizienz ist das Laserschweißen noch nicht weit verbreitet.
6. Zweifach-Schutzgasschweißen
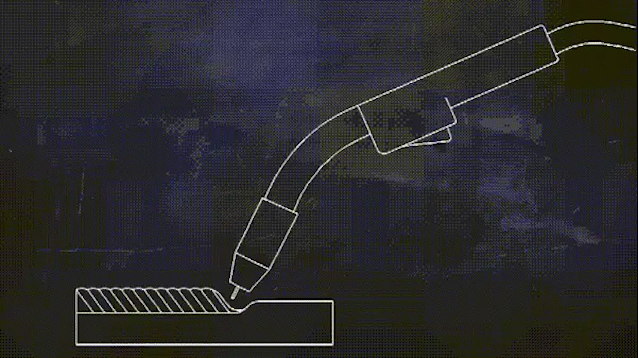
Zwei Schutzgasschweißverfahren (bekannt als Kohlendioxid-Schutzgasschweißen) für das Schweißen von niedriggekohltem Stahl und niedriglegiertem hochfestem Stahl bei verschiedenen groß angelegten Stahlbauprojekten, seine hohe Schweißproduktivität, gute Rissbeständigkeit, geringe Schweißverformung, Anpassung an den Verformungsbereich von großem Umfang, kann zum Schweißen von dünnen und mitteldicken Blechteilen verwendet werden.
7. Reibschweißen
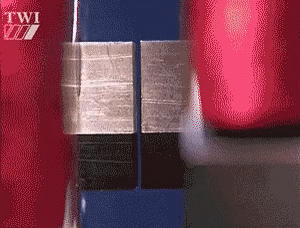
Beim Reibschweißen wird die durch die Reibung der Kontaktfläche des Werkstücks erzeugte Wärme als Wärmequelle genutzt, um das Werkstück unter Druck plastisch zu verformen und so ein Schweißverfahren durchzuführen.
Unter Druck, also unter der Einwirkung von konstantem oder inkrementellem Druck und Drehmoment, wird der Schweißkontakt zwischen der Relativbewegung der Stirnfläche in der Reibungsfläche und der umgebenden Reibungswärme und plastischer Verformungswärme genutzt, sodass die Temperatur des Bereichs und seiner Umgebung nahe am, aber im Allgemeinen unterhalb des Schmelzpunkts liegt. Dadurch wird der Verformungswiderstand des Materials verringert, die Plastizität der Grenzfläche verbessert sich, der Oxidfilm bricht unter dem Einfluss des Schmiededrucks auf, begleitet von plastischer Verformung und Fließen des Materials, durch molekulare Diffusion und Rekristallisation an der Grenzfläche wird das Schweißen im Festzustand realisiert.
8. Ultraschallschweißen
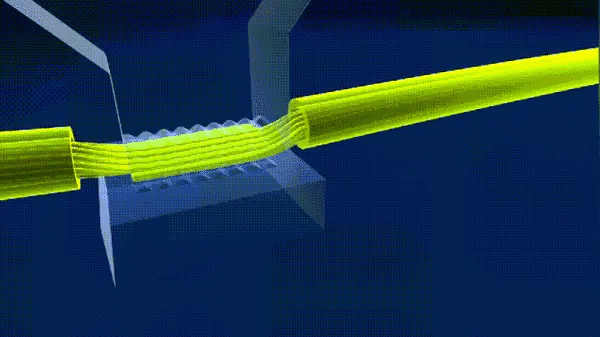
Beim Ultraschallschweißen werden hochfrequente Schwingungswellen unter Druck auf die Oberflächen der beiden zu verschweißenden Objekte übertragen, sodass diese aneinander reiben und eine Verschmelzung der Molekülschichten entsteht.
9. Weichlöten
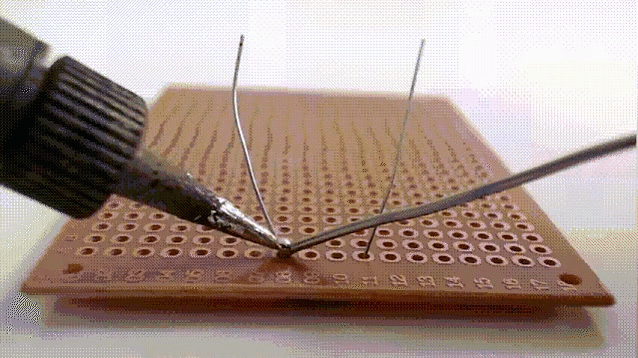
Weichlöten ist ein Fügeverfahren, bei dem ein Lötmaterial mit einem Schmelzpunkt von maximal 450 °C verwendet wird. Die Verbindung wird durch Erhitzen auf eine Temperatur hergestellt, die unter dem Schmelzpunkt des Grundwerkstoffs und über dem Schmelzpunkt des Lötmaterials liegt. Das Lötmaterial verteilt sich entweder durch Kapillarwirkung auf den Oberflächen der passgenauen Verbindung oder durch Benetzung der Werkstückoberfläche.
Weichlötzusätze sind Lötzusätze für das Weichlöten mit einer Schmelztemperatur von maximal 450 °C. Sie sind üblicherweise eisenfrei. Weichlötmaterialien sind in der Regel eisenfreie Legierungen. 450 °C markiert die Grenze zwischen Hartlöten und Weichlöten. Die meisten Prozessparameter und Einflussfaktoren beim Hartlöten gelten auch für das Weichlöten. Tatsächlich werden in der Industrie Begriffe wie Weichlöten, Hartlöten oder Silberlöten verwendet, um zwischen Weichlöten und Hartlöten zu unterscheiden.
10. Hartlöten

Hartlöten ist ein Hochtemperatur-Lötverfahren. Die meisten Hartlöttemperaturen liegen im Bereich von 1200 bis 1400 °F (deutlich höher als beim Weichlöten, aber deutlich niedriger als beim Schmelzschweißen). Wie beim Weichlöten beruht auch beim Hartlöten die Füllung der Lötstelle mit Lot auf Kapillarwirkung. Es gibt viele verschiedene Hartlötlegierungen, mit denen sich nahezu alle Metalle und Metalllegierungen verbinden lassen.
Veröffentlichungsdatum: 13. Februar 2025